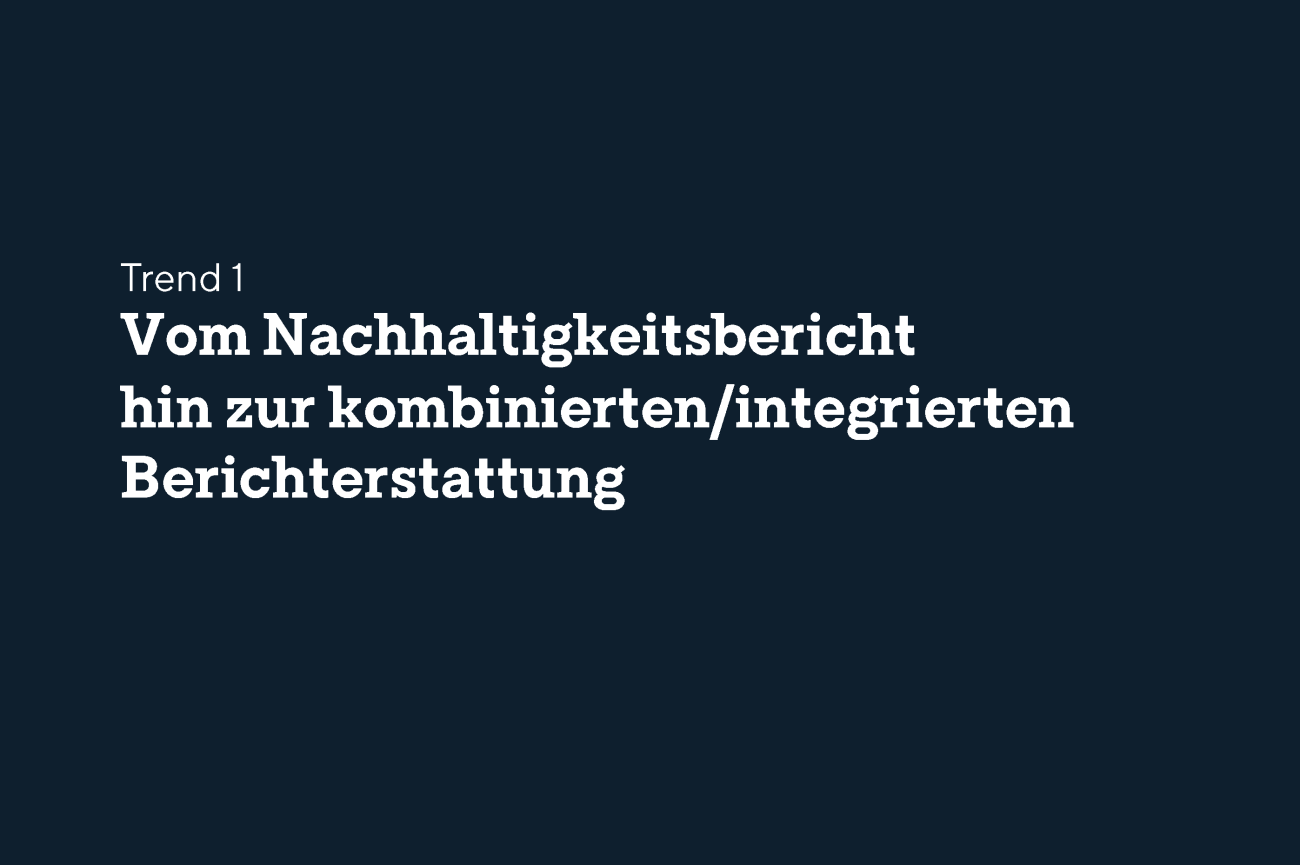«Die Sprache gehört zu diesen wichtigen systemischen Rahmenbedingungen, die uns täglich und oft unbemerkt beeinflussen.»
Unsere Kommunikationsberaterin Lucile Barras ist Teil unseres internen Projektteams zu gendergerechter Sprache. Im Interview spricht sie über die Entwicklung unseres Leitfadens, die Bestrebungen für eine inklusive Sprache in anderen Ländern und ihren persönlichen Umgang mit gendergerechter Kommunikation in ihrer Freizeit.

Lucile, wieso engagierst du dich für gendergerechte Sprache?
Im Verlauf meines Berufslebens wurde ich nach und nach auf die ungleiche Behandlung von Frauen und Minderheiten aufmerksam. Selbstverständlich empöre ich mich darüber und wünsche mir Gleichberechtigung für alle. Ich finde es faszinierend, wie unsere Sozialisierung, Erfahrungen und Wahrnehmung unser Verhalten beeinflussen. Die Sprache gehört zu diesen wichtigen systemischen Rahmenbedingungen, die uns täglich und oft unbemerkt beeinflussen. Der Philosoph Ludwig Wittgenstein schrieb: «Die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt.» Wer sich dessen bewusst wird, kann es nicht mehr ignorieren. Umso mehr habe ich mich gefreut, als ich festgestellt habe, dass es im Gegensatz zur Grammatik, Rechtschreibung und Interpunktion, wo jedes Detail klar geregelt ist, auch Sprachbereiche gibt, in denen Kreativität erlaubt ist. Zu den Freiheiten gehören z. B. die Erfindung neuer Begriffe und das Gendern. Diesen Freiraum dürfen wir nutzen.
Wieso hat sich Polarstern entschieden, einen Leitfaden zu gendergerechter Sprache zu entwickeln?
Als Kommunikationsagentur redigieren wir täglich Texte. Ganz automatisch stiessen wir auf genderbezogene Textstellen, bei denen wir Entscheidungen treffen mussten. Innerhalb von Polarstern kamen dabei verschiedene Sensibilitäten zum Vorschein. Es war deshalb sinnvoll, uns als Agentur Klarheit zu verschaffen und eine gemeinsame Position zu erarbeiten. Jetzt können wir unserer Kundschaft auch in dieser Hinsicht eine einheitliche Sprachqualität offerieren, zu der wir voll stehen.
Du hast den Leitfaden zusammen mit zwei Team-Kolleginnen entwickelt. Wie seid ihr vorgegangen?
In einem ersten Schritt haben wir alle Möglichkeiten mit deren Vor- und Nachteilen gesammelt und in einer Teamsitzung besprochen. Von den neutralen Formen abgesehen, zogen manche Mitarbeitende den Genderstern vor, andere den Genderdoppelpunkt. Der Genderdoppelpunkt hat schliesslich am meisten überzeugt, weil er sich besser ins Schriftbild einfügt und von Sprachprogrammen erkannt wird.
In einem zweiten Schritt haben wir untersucht, welche Positionen einschlägige Referenzen wie der Duden, Universitäten, grosse Medienhäuser und NGOs einnehmen. Es gibt so viele Ratschläge wie Institutionen. Viele Leitfäden sind auf ein bestimmtes Sprachfeld spezialisiert: So beziehen sich manche Universitäten bspw. ganz klar auf Ansprachen an Studierende, während andere Leitfäden genderneutrale Formulierungen von Stellenausschreibungen beleuchten. Weitere Leitfäden fordern zum Nutzen der vielfältigen Möglichkeiten auf. Das ist gut und richtig, um bei der Redaktion eine maximale stilistische Freiheit zu behalten. Zu viel Freiheit kann aber auch verwirren. Deshalb haben wir ein schrittweises Abklären der Möglichkeiten entwickelt, an dem man sich systematisch entlangangeln kann.
Wart ihr euch von Anfang an einig, welche Empfehlungen der Leitfaden abgeben soll?
Nein, es gab weiterhin unterschiedliche Präferenzen, z. B. im Umgang mit juristischen Personen, bspw. wenn von einem Geschäftspartner oder einem Lieferanten die Rede ist. In der deutschen Sprache gibt es die synonymen Begriffe «die Firma», «das Unternehmen» und «der Betrieb», mit unterschiedlichen grammatischen Geschlechtern. Wir sind zum Schluss gekommen, dass es nicht nötig ist, juristische Personen zu gendern, solange nur die Organisationen bezeichnet werden, also in unseren Beispielen die Partnerfirma oder das Lieferunternehmen, und nicht direkt die dahinterstehenden natürlichen Personen.
Auch zur Weglassprobe gab es verschiedene Ansichten. Aus grammatikalischer Sicht darf der Genderdoppelpunkt nur gesetzt werden, wenn das Wort vor dem Doppelpunkt vollständig ist und beim Weglassen des Doppelpunktes der Begriff ebenso korrekt ist: z. B. Leser:innen. Laut dieser Regel funktioniert der Begriff «Kund:innen» nicht, weil «Kund» kein eigenständiger Begriff ist. Manche wollten sich strikt an diese Regel halten, andere fanden sie zu restriktiv, weil das Auge ja auch «Kunden» lesen kann, wenn es «:inn» auslässt. Wir beschlossen zum Schluss, dass wir dies unseren Lesenden zutrauen.
Du bist bilingue: Wie weit ist die französische Schweiz in Bezug auf gendergerechte Sprache?
Im französischen Sprachraum ist die Debatte gerade auch sehr aktuell. Die französische Sprache ist möglicherweise noch frauenfeindlicher als die deutsche. Bezeichnend dafür ist z. B. die unterschiedliche Definition von «maître» (= Herr, Meister, juristische Amtsperson) und «maîtresse» (= Geliebte). Solche Beispiele gibt es viele.
Der Blick in die Archive der Sprachgeschichte hilft den Französinnen, ihr Recht auf eine gendergerechtere Sprache geltend zu machen: Die unter Ludwig XIII von Richelieu gegründete Académie française setzte ab 1635 eine französische Sprache durch, in der das Maskulin immer dominanter wurde. Das skurrile Beispiel ist, dass im bisher gültigen Französisch ein männliches Adjektiv eingesetzt wird, wenn es eine Gruppe von 100 Frauen und einen männlichen Hund beschreibt. Viele weibliche Berufsbezeichnungen wurden aus dem Sprachgebrauch ausradiert. Selbst die Bäckerin bezeichnete plötzlich nur noch die Ehefrau des Bäckers. Und eine Anwältin konnte sich noch vor wenigen Jahren nur Respekt verschaffen, wenn sie sich als Anwalt bezeichnete.
Heute werden die vergessen gegangenen weiblichen Bezeichnungen wieder aktiviert und wie in Deutsch die nicht-männlichen Anteile einer Gruppe sichtbar gemacht. Dazu benutzt man im Französischen den Mediopunkt. Des Weiteren hat dieses Jahr das französische Wörterbuch «Robert» mit der Aufnahme des inklusiven Pronomens «iel», einer Mischung zwischen «il» und «elle», für Aufruhr gesorgt.
Welche Bestrebungen für eine gendergerechte Sprache gibt es in anderen Ländern?
Die Hälfte aller Sprachen kennt kein grammatisches Geschlecht (der/die/das), wie z. B. das Englische, Finnische oder Japanische. Japanisch sieht deswegen auf den ersten Blick inklusiv aus, doch das täuscht: Frauen müssen sich viel höflicher ausdrücken als die Männer.
In den meisten Sprachen bleiben die Pronomen, die nach Geschlecht unterscheiden. Im Englischen hat sich schon seit längerem «they» als neutrales Fürwort durchgesetzt. Finnland schenkte der Welt in einer internationalen Kommunikationskampagne sein inklusives, genderneutrale Fürwort «hän» als Dank für Lehnworte, die aus anderen Sprachen ins Finnische übernommen wurden. Möglicherweise haben sie damit die Französinnen und Franzosen zum «iel» inspiriert? Wie wär’s, wenn wir in Deutsch «sier» einführten?
Im Spanischen bestimmt oft das Wortende auf «o» oder «a» das Geschlecht, z. B. Latino oder Latina. Als genderneutrale oder inklusive Alternative wird nun dort das @-Zeichen oder ein «x» eingesetzt: Latin@ oder Latinx. Sehr erfrischend fand ich auch das Werk des Genfer Typografiestudenten Tristan Bartolini, der inklusive Buchstaben entwickelt hat.
Eine letzte Frage, Lucile: Achtest du auch in deiner Freizeit (bei Nachrichten, Briefen etc.) auf gendergerechte Sprache?
Ich versuche es, aber der Reflex ist noch nicht vollständig etabliert. Am schwierigsten ist es in der mündlichen Sprache.
Interview: Julia Gremminger
Leitfaden «Gendergerechte Sprache leicht gemacht» [PDF]
Gendern leicht gemacht – mit dem Leitfaden von Polarstern
Blogbeitrag (14.12.2021)
Sprache als wichtige systemische Rahmenbedingung
Interview mit Lucile Barras (10.01.2022)
Mehr zum gendergerechten Schreiben
Die Ungleichheit zwischen den Geschlechtern wird in der Agenda 2030 als eines der grössten Hindernisse für nachhaltige Entwicklung, ökonomisches Wachstum und Armutsreduktion anerkannt. Die männliche Dominanz wird auch durch die Sprache vermittelt. Zeitgemässe Sprache ist gendergerechte Sprache. Gendergerechte Sprache hat zum Ziel, die Gleichstellung der Geschlechter abzubilden. Dies bedeutet, dass sämtliche Geschlechter, das heisst weiblich, männlich sowie nicht-binär, gleichermassen sichtbar als auch hörbar gemacht werden.